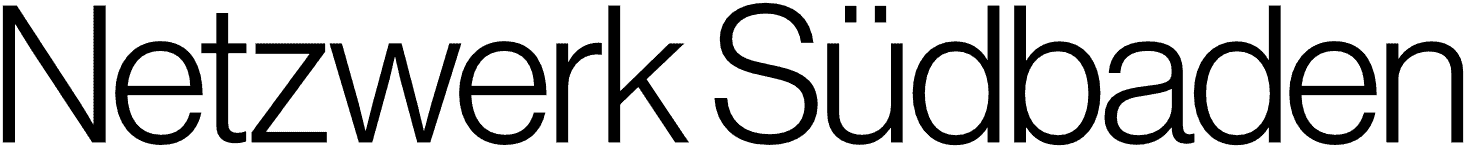Katharina Schuler trat als 26-Jährige eine große Nachfolge an. Ihr Opa hatte mit dem Ulmer Bier eine bekannte Marke geschaffen. Die Enkelin muss sich nun in einem schrumpfenden Markt beweisen. Ein Besuch bei der Familienbrauerei Bauhöfer in Renchen-Ulm.
Text: Julia Donáth-Kneer • Fotos: Alex Dietrich
„Willkommen im Bierdorf Ulm“ steht am Ortsschild von Renchen-Ulm. Hier, im vorderen Renchtal in der Ortenau, hat die Familienbrauerei Bauhöfer ihren Sitz direkt neben der örtlichen Kirche – seit 1852. Statt einer Industrieabfüllhalle befinden sich auf dem rund 35.000 Quadratmeter großen Gelände mehrere verwinkelte Keller, ein breiter Hof, eine alte Villa und das Gasthaus Braustüb’l. Mittlerweile ist aus der kleinen Hausbrauerei ein Mittelständler geworden. 35 Menschen arbeiten für Bauhöfer, teilweise seit Jahrzehnten. Auch Katharina Schuler ist trotz ihres Alters schon lange dabei. 2019 stieg sie als Assistenz der Geschäftsleitung ein, ab 2020 war sie Teil der Geschäftsführung, seit 2024 ist sie alleinige Geschäftsführerin und verantwortet die Brauerei in fünfter Generation.
Wie war das damals, als die Enkelin den Seniorchef ablöste? „Intern gab es nur positives Feedback“, erzählt Katharina Schuler. Die Angestellten hätten sich vor allem gefreut, dass es weitergeht und dass es mit ihr wieder eine familieninterne Nachfolge gibt. Denn das war nicht abzusehen. Katharina Schulers Mutter, geborene Bauhöfer, hatte kein Interesse am Unternehmen und so war zuvor mit Siegbert Meier 20 Jahre lang ein externer Geschäftsführer und Gesellschafter an Bord. Er ist auch heute noch im Betrieb, aber nicht mehr am operativen Geschäft beteiligt.
Extern sei der Start etwas holpriger gewesen. Anfangs habe sie sich als junge Frau manchmal gegen Lieferanten und langjährige Kunden behaupten müssen, vermutlich wäre ein junger Mann auf weniger Widerstand gestoßen. „Die Getränkeindustrie und die Brauereibranche sind sehr männerlastig“, erklärt Katharina Schuler. Sie wirkt nicht wie eine, die sich davon unterkriegen lässt. Und auch nicht wie eine, an der etwas unbemerkt vorbei geht. Es passiert, berichtet sie, dass sie ungefragt geduzt wird oder dass ein Geschäftspartner ihren männlichen Kollegen adressiert, obwohl sie diejenige ist, die die Entscheidungen trifft.
Keine Babypause
Katharina Schuler ist gerade zum zweiten Mal Mutter geworden. Ihre wenige Wochen alte Tochter schläft friedlich während des Interviews. Babypause gibt es für die Chefin nicht. „Familybusiness“, sagt die 31-Jährige. „Wirklich raus kann ich da nicht, aber das hat ja auch Vorteile.“ Es sei immer jemand da, der ihr die Kleine auch mal abnimmt. Schuler wusste nicht von Anfang an, ob sie mal ins Familienunternehmen einsteigen würde. Aber zumindest legte sie die Karten richtig: BWL-Studium an der dualen Hochschule in Villingen-Schwenningen, Ausbildung im Familienbetrieb. „Damit decke ich die kaufmännische Seite ab“, erklärt sie. Die technische läuft über einen anderen Familienstrang: ihre Großcousine Elisabeth Bauhöfer und deren Mann Alexander Schneider, der Braumeister, verantworten die Produktion. „Diese Aufteilung ist bei uns fast schon historisch“, sagt Schuler. „Schon mein Opa war der Kaufmann, sein Cousin der Braumeister“.
Nach dem Bachelorabschluss war Katharina Schuler blutjung, gerade mal 21 Jahre alt. Also machte sie zunächst etwas ganz anderes: eine Tanzsportausbildung in Freiburg. „Natürlich hätte es mein Opa gerne gesehen, dass ich in den Betrieb zurückkomme, aber er machte mir keinerlei Druck“, erinnert sie sich. Selbst als klar war, dass sie sich doch für die Branche interessierte, wollte sie vorher noch Großbrauereiluft schnuppern, arbeitete zwei Jahre lang bei Dinkelacker in Stuttgart sowie bei Traunsteiner am Chiemsee. 2019 kam sie dann als Assistentin der Geschäftsleitung nach Renchen-Ulm zurück und übernahm in der Folge die Geschäftsführung.



Eine ihrer ersten Amtshandlungen: Das angestaubte Image der Marke aufpolieren. Ulmer Bier ist in der Ortenau eine feste Größe mit klarer Zielgruppe: Männer, 55 plus. Doch die Quote der Biertrinker sinkt, da müssen sich Brauereien etwas einfallen lassen. 2023 wurden noch 88 Liter pro Kopf getrunken, 1980 war es noch nahezu doppelt so viel (147 Liter). Nur auf alkoholfreie Varianten zu setzen, hilft nicht. 2019 entwickelte Bauhöfer gemeinsam mit einer Agentur eine neue Strategie, um die Marke „Bauhöfer“ mehr ins Bewusstsein rücken. „Es stand schon immer Familienbrauerei Bauhöfer auf den Flaschen, das Bier aber hieß Ulmer. Das wollten wir ändern“, erklärt Schuler. Der Generationswechsel vom Opa zur Enkelin schien wie geschaffen dafür. Drumherum entstand eine aufwendige Marketingkampagne, in die die Brauerei insgesamt rund zwei Millionen Euro investierte. Größter Kostenpunkt waren die neuen Bierkisten, rund 80.000 zum Stückpreis von 5 bis 6 Euro. Hinzu kamen Verpackung, Etiketten, 360-Grad-Marketing. Dazu gehörten Social-Media-Motive genauso wie Plakatkampagnen und klassische Printanzeigen. „Wir wollten ja auch unsere bisherige Hauptzielgruppe erreichen und die liest eher Zeitung als auf Facebook“, sagt Schuler.
Das Hauptmotiv der Kampagne hängt heute gerahmt im Treppenhaus des Verwaltungsgebäudes der Brauerei, liebevoll „alte Villa“ genannt. Darauf zu sehen: ein Schwarzweißmotiv von Opa und Enkelin. Es sei die „Kombi aus Tradition und Moderne, um die es uns geht“, sagt Schuler. Eine schöne Erinnerung, denn Seniorchef Eugen Bauhöfer ist vor zwei Jahren im Alter von 92 Jahren verstorben.
Brauereienschwund
Kurz nach dem Relaunch kam Corona, Gastronomiebetriebe schlossen, viele kleine Brauereien kämpften ums Überleben. In Deutschland, dem Land mit der höchsten Brauereidichte weltweit, ist in der Folge die Zahl der Brauereien in den vergangenen fünf Jahren um 93 auf 1459 gesunken, wie der Deutsche Brauer-Bund (DBB) im März mitteilte. Am stärksten vom Rückgang betroffen ist Bayern, wo sich auch mit Abstand die meisten Brauereien befinden, aber auch in Baden-Württemberg fiel die Zahl der Brauereien: In den vergangenen drei Jahren von 214 auf 203. Das betrifft viele Traditionshäuser: „Bei den Betriebsaufgaben sehen wir etwa gleich viele Gründer wie alte Familienbetriebe“, sagt DBB-Präsident Christian Weber. Zudem seien Gründungen vor allem von Craftbeer-Brauereien, die bestimmte Lücken für eine Weile füllen konnten, inzwischen sehr viel seltener geworden. Weber zählt eine ganze Palette an Gründen auf: „Erst kam die Corona-, dann die Energiepreiskrise. Da ist gerade bei kleineren Betrieben oft viel Kapital abgeflossen. Jetzt kommt noch die allgemeine Konsumzurückhaltung hinzu. Gegenüber den großen Lebensmittelkonzernen können Brauereien die Preise, die sie eigentlich bräuchten, kaum durchsetzen. Das ergibt für manche Betriebe dann eine Falle, aus der sie nicht mehr herauskommen“, sagt der Experte. „Irgendwann ist die Kapitaldecke so dünn geworden, dass eine Entscheidung fallen muss. Auch wenn das bedeutet, nach drei, vier oder sogar sieben Generationen aufzugeben, was natürlich besonders weh tut.“

Katharina Schuler ist heilfroh, dass es ihren Traditionsbetrieb nicht betrifft. „Wir sind eine vergleichsweise kleine Brauerei und haben im Vergleich zu Großbrauereien Geschäftsvorteile“. Der Umsatz generiert sich zu rund 60 Prozent aus dem Verkauf von Flaschenbieren, nur 40 Prozent aus der Gastronomie. „Natürlich hat uns Corona Umsatz, aber nicht die Existenz gekostet. Wir sind aber auch noch nicht auf 2019er Niveau“, sagt Schuler. „Ob wir da wieder hinkommen, kann ich nicht sagen.“ Sicher ist: Mit den Dumpingpreisen der großen Biermarken wie Becks, Jever oder Heineken – Katharina Schuler nennt sie „Fernsehbiere“ – können kleine Brauereien nicht mithalten. Heute braut Bauhöfer 17 verschiedene Sorten, dazu kommen Sonderbiere – und eine Besonderheit, die fast schon ein Alleinstellungsmerkmal ist. Denn das Bauhöfer gibt es, wie das Ulmer Bier seit 30 Jahren schon, mit Schraubverschluss statt mit Kronkorken. Da es aber für diese Technik kaum Abnehmer gebe, seien die Preise für den Verschluss mittlerweile viel zu hoch. „Daher werden wir künftig vorausichtlich auch wieder auf den Kronkorken setzen.“