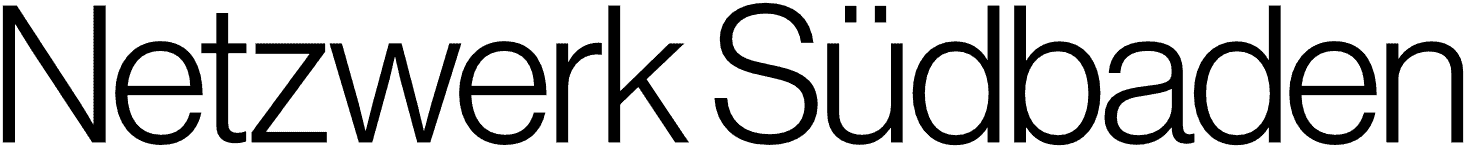Kinder an die Macht? Von wegen. Der Einfluss junger Menschen in Politik und Wirtschaft schwindet eher. Ein fast 70-Jähriger wird wohl Bundeskanzler, und die meisten Dax-Vorstände sind Mitte 50.
Text: Kathrin Ermert
Die Alterung der Menschen in Deutschland lässt sich auf der Webseite des Statistischen Bundesamts beobachten. Wenn man mit dem Cursor die Bevölkerungspyramide in Bewegung bringt, wandern die dicksten Stellen nach oben, während der Sockel schmäler wird. 1964 kamen mehr als 1,36 Millionen Menschen in Deutschland zur Welt, 2024 waren es rund 760.000. Der geburtenstärkste Jahrgang der Bundesrepublik hat schon seinen 60. Geburtstag gefeiert, und es rücken wenige junge Menschen nach, auch wenn die Einwanderung immerhin für eine Stabilisierung der jüngsten Altersgruppe sorgt. Die Prognose der Kultusministerkonferenz geht sogar von einer leichten Steigerung der Zahl der Schülerinnen und Schüler bis 2030 aus.
Das ändert allerdings nichts daran, dass in Deutschland einer kleinen Zahl junger Menschen wesentlich mehr alte gegenüberstehen und viele politische Entscheidungen an den Älteren ausgerichtet werden. „Warum geht die Politik nicht mehr auf die Bedürfnisse und Wünsche der Jungen ein?“, wollte eine Teilnehmerin vor Kurzem von Julia Reuschenbach wissen, die Gast einer Podiumsdiskussion in Freiburg war. „Weil es sich nicht lohnt“, antwortete die Berliner Politikwissenschaftlerin. Es klinge zynisch, aber die Jungen seien zu wenige, ihre Stimme habe zu wenig Gewicht. Das zeigt die Statistik der jüngsten Bundestagswahl deutlich: Nicht einmal vier Prozent der insgesamt knapp 60 Millionen Wahlberechtigen gaben zum ersten Mal ihre Stimme ab, etwa die Hälfte war zwischen 30 und 59 Jahre alt, jede vierte wahlberechtigte Person älter als 69 Jahre. Dem Wahlvolk entsprechend liegt das Durchschnittsalter der Abgeordneten, das sich im Vergleich zur vorangegangenen Legislaturperiode zwar geringfügig verjüngte, jetzt bei 47,1 Jahre. Die ältesten Abgeordneten hat die AfD -Fraktion (Altersdurchschnitt: 50,7 Jahre), die jüngsten Die Linke (42,2 Jahre).
Im Landtag von Baden-Württemberg sind die Abgeordneten sogar durchschnittlich 53,1 Jahre alt. Repräsentative Werte zur Kommunalpolitik im Land gibt es nicht. Doch immerhin ziehen in die Rathäuser im Südwesten regelmäßig sehr junge Männer, manchmal auch Frauen ein. So hat Anfang April der 25-jährige Tobias Pollay in Willstätt das Amt des Bürgermeisters angetreten. Und im Februar hat der 29-jährige Hendrik Mench die Bürgermeisterwahl in Sexau gewonnen. Dass Jüngere die Macht in baden-württembergischen Rathäusern übernehmen, ist gewollt: 2023 hat der Landtag das Mindestalter für die Kandidatur von 25 auf 18 gesenkt – allerdings zugleich die Ruhestandsaltersgrenze von 73 Jahren abgeschafft. Anders als viele ältere Rathauschefs sind Pollay und Mench speziell für ihr Amt ausgebildet. Beide haben an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl studiert. Der Nachwuchs dort lässt auch hoffen, dass der bislang magere Frauenanteil von derzeit unter zehn Prozent auf den Chefsesseln der Rathäuser künftig steigt. Denn die Preise des diesjährigen Abschlussjahrgangs im Bachelorstudiengang „Public Management“ gingen an zwölf junge Frauen und nur an drei junge Männer.
In der Wirtschaft sind immerhin schon knapp ein Drittel der Führungskräfte Frauen, und auch die Altersstruktur sieht in Unternehmen etwas besser aus als in der Politik: Laut einer Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft waren Führungskräfte vergangenes Jahr im Durchschnitt 43 Jahre alt. Allerdings steigt das Alter mit der Position und Unternehmensgröße. Dem Dax-Vorstands-Report des Beratungsunternehmens Odgers Berndtson zufolge waren die Vorstände der Dax-Unternehmen durchschnittlich 55 (die Männer) beziehungsweise 53 Jahre alt (die Frauen).