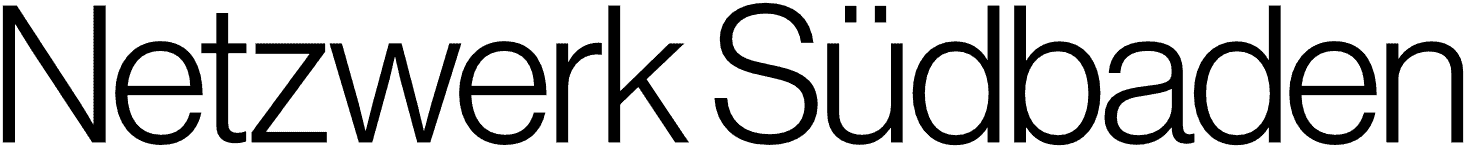Wer in die „Central-Station“ möchte, muss die Treppe hinunter. Der neue Spielplatz der Basler Kulturszene liegt unter der Erde, im Untergeschoss einer ehemaligen Migros-Filiale.
VON STEPHAN ELSEMANN
Ein Zentralbahnhof im Untergrund mitten in der gediegenen Basler Innenstadt zwischen Theater, Bahnhof SBB und Aeschenplatz gelegen – das hat schon etwas Subversives. Zwanzig Häuser, Studios oder Ladengeschäfte finden Platz auf rund 2000 Quadratmetern. Gastronomie ist dabei, die Lucky’s Bar, eine schicke Bar mit Wohlfühlcharakter, die Cucina, ein Bistro mit mediterranen Snacks und kleinen Gerichten, doch auch ein Tattoo-Studio, ein Second-Hand-Laden, ein Geschäft für Designer-Lampen, eine Schreiner-Werkstatt, alles so, wie es in einer richtigen Stadt sein könnte. Das Ganze strahlt Gemütlichkeit aus, zwischen Markthalle und einer Shopping-Mall mit Retro-Charakter. Doch wo bleibt die Kunst bei der temporären „Kunst- und Alltags- Kulturintervention“, die es nach dem Willen des Initiators Klaus Littmann sein soll?

Unzählige Projekte hat er in den letzten Jahrzehnten umsetzen können – meist in Zusammenarbeit mit anderen Künstlern. Es sind Projekte zu Phänomenen der Alltagskultur wie Fußball, Fahrrädern oder die Simulation einer Stadt wie aktuell bei der „Central Station“. Eine andere Facette seiner vielfältigen Projekte ist etwa das Real Fiction Cinema. Zusammen mit dem niederländischen Künstler Job Koelewijn baute Littmann Kinosäle, die statt der Leinwand ein rechteckiges Fenster nach draußen haben. Es sind Guckkästen zur kollektiven Betrachtung der realen Welt draußen als einen Film.
Das temporäre Kino war mehrfach ein großer Erfolg, zuerst in Basel und Bern, im letzten Jahr noch einmal in China. Littmann ist eine feste Größe im Basler und Schweizer Kulturleben. 2002 erhielt er für seine Arbeit den Kulturpreis der Stadt Basel. Er ist Initiator, Anreger, Vermittler, Ermöglicher – ist er auch Künstler? „Das hier ist meine Kunst“, sagt er und mit dem erweiterten Kunstbegriff von Joseph Beuys lässt sich auch die „Central Station“ recht gut verstehen. Denn eine „soziale Skulptur“, das ist die Stadtsimulation ganz ohne Zweifel.
Um diese Verschmelzung von Kunst- und Alltagsraum zu ermöglichen, dafür war der Beitrag des in Belgien lebenden Künstlers Franz Burkhardt ganz wesentlich. Denn die Simulation hat einen überaus realen Charakter. Mit größter Akribie baute Burkhardt völlig real wirkende Elemente einer Straße nach, mit all ihren Zeichen der Vergänglichkeit, wie sie sich auch in realen Straßen wiederfinden. Briefkästen mit Beulen, verwitterte Rohre, auch das vermeintlich aus Kacheln gefertigte, übergroße und an eine U-Bahn-Haltestelle erinnernde Wandrelief der Central-Station selbst – dies alles aber sind Holz, Pappe, Kleister und Farbe. Die Illusion der Objekte ist so perfekt, man muss sie schon anfassen, um zu spüren, dass sie sich nicht kalt anfühlen wie Metall oder Keramik, sondern warm wie die Pappe, aus der sie gemacht sind.
Ein Telefon-Schalterhäuschen ist dabei, so wie sie zu Hunderten auf den Straßen stehen – mit all ihrer Patina. Verschmierte, halb abgerissene Aufkleber, dies alles hat Franz Burkhardt mit größtem Aufwand nacherfunden. Je länger man hinschaut, desto mulmiger wird es. Denn es lässt an die unbekannte Geschichte echter Spuren auf echten Kästen in den Straßen denken. Dani Frey und Raoul Morgenegg, die beiden Handwerker, die Franz Burkhardt bei der Umsetzung seiner Ideen und der Errichtung der Räume halfen, haben einen eigenen Raum in der Central-Station bekommen. Ihre Dienste kann man buchen, oder auch Kaputtes zur Reparatur vorbeibringen.


Vielleicht sollte man sich in der Central Station einfach treiben und inspririeren lassen, und nicht zu viele Gedanken machen. Etwa, warum das berühmte Logo der Londoner Tube für die Basler „Central Station“ herhalten musste und was die Londoner Tube mit Basel zu tun haben könnte. „Es gefiel mir einfach“ ist die entwaffnende Antwort des strahlenden Klaus Littmann. Das ganze Projekt ist auf drei Jahre angelegt, so lange haben die Eigner der Immobilie Klaus Littmann die Regie überlassen. Und danach? „Dann sieht man weiter“, sagt er, er selbst werde aber nicht ewig bleiben, schließlich wolle er ja nicht zur Kellerassel werden.
Mehr interessante Artikel gibt es in der Printausgabe von netzwerk südbaden zu lesen. Ein kostenloses Probeexemplar kann hier bestellt werden:
info@netzwerk-suedbaden.de
Mehr zu Basels Kulturprojekten gibt es unter:
http://www.klauslittmann.com/aktuelles