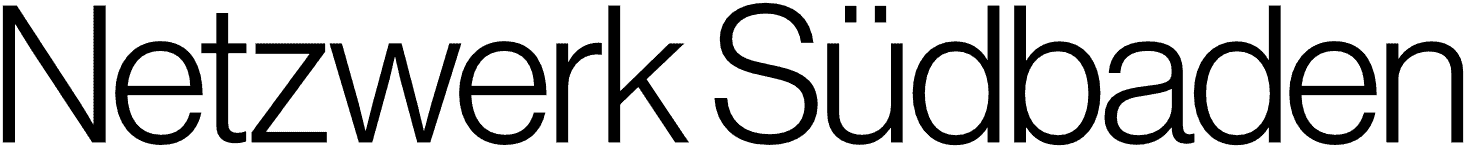Wenig neue Räume, kaum neue Akteure. Die Stadt Freiburg könnte ihren 230.000 Einwohnern ein wenig mehr Spannung in Sachen Lebensqualität bieten. Wirtschaftlich steht sie ordentlich da, beim Wohnen kommen große Aufgaben auf sie zu. Und eines beherrscht sie in Sachen Lebensqualität gar nicht.
VON RUDI RASCHKE
Fangen wir mit dem Schlimmsten an: Freiburgs öffentlichen Plätzen. Nach diesem Sommer sollte im Rathaus darüber nachgedacht werden, ob sie nicht in fremde Verwaltung gegeben werden können – am besten vielleicht in französische oder italienische Hände. Wenn Freiburg eines nicht kann, dann das Bespielen von Plätzen. Keine Spur von Dolce Vita, keinerlei Gedanken an eine Stadt als Bühne.
Der Stühlinger Kirchplatz feiert demnächst sein 20-Jähriges in der Hand von Dealern, er wird lediglich an zwei halben Markttagen von Normalbevölkerung genutzt. Der Platz der Alten Synagoge ist eine beige Granitwüste, die nicht wie geplant von der ganzen Stadtgesellschaft bespielt wird, sondern eher von Remmidemmi-Kids. Plus zahllose Demonstrationsübungen, ver.di-Zelt oder Doppeldeckerbus für direkte Demokratie. Und am Fahnenbergplatz wird gerade erprobt, wieviel Flair ein Chlorbrunnen, ein Vertriebenendenkmal und eine ausrangierte Telefonzelle entfalten, wenn die Stadt ein paar Stühle dazu stellt. Die Liste lässt sich mit weiteren freudlosen Orten wie dem Eschholz- oder dem Colombipark fortsetzen.


Man muss nicht zwingend ans Rheinufer ins benachbarte Basel schauen. Dort sorgt ein Container-Konzept dekorativer „Buvetten“ dafür, dass auch werktätige Erwachsene ein schönes Glas Wein im Freien bekommen und sich unter weniger betuchte Jugendlichemit Pizzakarton mischen, Stadtgesellschaft eben. Auch am alten Freiburger Wiehrebahnhof kommt bei Bewirtung und Boule ein wenig Lebensqualität für Fortgeschrittene zustande (wenn auch bisweilen als arges Klischee).

Von Platzwüsten einmal abgesehen: Die Stadt schlägt sich bei den statistischen Daten im Vergleich der Kreise im Regierungsbezirk überraschend gut: Bei der Bildung steht sie von der Kita- bis zur Akademikerquote wie erwartet an der Spitze. Bei den Gewerbesteuer-Einnahmen (natürlich nicht zuletzt aufgrund des hohen Hebesatzes) belegt sie Platz 2 im Regierungsbezirk. Bei den Kfz-Zulassungen bringt sie den umweltfreundlichsten Beitrag aller Kreise, obwohl die Zahlen auch hier weiter zulegen.

Die Schwächen liegen in Teilen der Wirtschaft: Beim Anteil der Beschäftigten an allen im erwerbsfähigen Alter, vor allem aber beim verfügbaren Einkommen gehören die Freiburger zu den Schlusslichtern. Und nicht zuletzt haben sie beider Zahl der fertiggestellten Wohnungen die wenigsten Baustellen. Aber beiden Kaufpreisen die teuersten. Dies ist gerade mit Blick auf das größte Bevölkerungswachstum aller Kreise beachtlich, wird aber mit den sehr großen Baumaßnahmen Dietenbach und Kleineschholz in den kommenden Jahrzehnten aufgefangen. Die Dynamik, in der beispielsweise die Wirtschaftswoche in ihrer Rangliste 2021 einen der großen Vorteile Freiburgs sah, könnte hier wieder Fahrtaufnehmen.

Die Gastronomin Martina Feierling-Rombach ist Unternehmerin und einstige Lokalpolitikerin (CDU), sie setzt sich für Frauen als Firmenchefs ebenso ein wie für eine funktionierende Innenstadt. Über ihre Wahrnehmung von Lebensqualität sagt sie, dass sie nach einem „insgesamt tollen Sommer 2022“ zwar noch keine Einbußen sehe, aber befürchtet, dass sich dies ändere. Beim Konsum in der Stadt fürchtet sie solche Einbußen, „wenn zu den durchschnittlich 40 Prozent vom Gehalt, die für Miete fällig werden, noch die Teuerung dazu kommt.“
Zurückhaltung sei also demnächst angemessen, sagt Feierling-Rombach, vielleicht müsse die Stadt selbst gegensteuern. Dass beim Einzelhandel erstmals eine richtige Unterstützung stattfinde, sei unübersehbar. „Ohne Innenstadt kann man den Rest vergessen“, sagt die Unternehmerin, diese Erkenntnis sei während der Corona-Zeit unübersehbar gewesen. Vor allem aber, dass es nur im Zusammenspiel gehe. Dem Einzelhandel ging es schlecht, als die Gastronomie geschlossen war. Die Fashion Days Mitte September, eine sympathische Gewerbeschau ohne Hüpfburg, sind diesbezüglich ein Neuanfang.

Martina Feierling-Rombach lebt und arbeitet in der Oberen Altstadt im Osten der City, wo unübersehbar ein qualitativer Aufbruch bei Bars, Boutiquen, Einzelhandel und Restaurants am Laufen ist. Mit Martin Fausters Wolfshöhle und Amadeus Kuras Löwengrube sind dort die beiden besten neuen Restaurants zu finden. Trotzdem bietet die Stadt entgegen ihrer Selbstdarstellung als Gourmet-Region aktuell nicht einmal einen Michelin-Stern und hat sonst wenig Spitze, die die Breite mitziehen könnte. Mit Friedrich Kellers Trotte verfügt das Zentrum der Weinregion über gerademal ein entsprechendes Lokal. Im Rest der Innenstadt findet vielerorts Dönerisierung, aber auch Leerstand statt. Feierling-Rombach sieht hier auch die Hauseigentümer in der Pflicht.
Für Arbeitgeber vor den Toren der City stellt die Stadt traditionell keinen großen Industriestandort dar, Universität und Uniklinik bleiben die größten Arbeitgeber. Mit Haufe, Stryker oder dem stark wachsenden Dienstradanbieter Jobrad folgen aber Unternehmen, die zum Wissenschaftsstandort passen und Potenzial haben – ganz ohne rauchende Schornsteine. Hinzu kommen Forschungsausgründungen aus der Universität, aber erstmals auch ein Platz unter den Top Ten der meisten neuen Start-ups in Deutschland – Fraunhofer und Grünhof sind hier starke Motoren.

Wenn künftig in den Städten die eigentlichen Lösungen für Themen wie Nachhaltigkeit, sozialen Zusammenhalt und Mobilität der Zukunft gefunden werden, könnte Freiburg eine gute Rolle spielen. Die Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, Klara Geywitz, spricht in diesem Zusammenhang von urbaner Resilienz als lokaler Antwort auf globale Krisen. Das alles sind Themen, die in Freiburg auf eine stabile Zivilgesellschaft treffen.
Dennoch eine Herausforderung in Freiburg: Es gibt praktisch keine Gewerbeflächen mehr und auch keine spannenden Konversionsflächen, wo Neues aus Altem entstehen kann. Eine der größten Chancen, die alte Stadthalle am Messplatz, lässt die Stadtverwaltung nunmehr seit Jahren ungenutzt liegen. Ein erster Elfmeter wurde quasi schon verschossen, als die Macher der Black Forest Studios nicht hier, sondern im Kurhaus Kirchzarten einzogen. Im Freiburger Rathaus hätte das ein Weckruf sein können in Sachen Konkurrenzfähigkeit.

Ein wenig Wirklichkeitsgymnastik (den Begriff erfand ein deutscher Stadtentwickler kürzlich) täte der Stadt vermutlich gut. Vor allem der Oberbürgermeister steht für ein „Work aloud“ im Superlativ-Modus, egal, ob er das vermeintlich größte Solarstadiondach des Universums einweiht oder eine der größten Radweg-Investitionen bundesweit. Dahinter kommt die Kraft zur Reflexion oder Perspektivwechsel zu kurz. Und wer sich permanent als Riese aufführen muss – betreibt der nicht in Wirklichkeit seine eigene Verzwergung?
Bietet die Stadt denn bei allem Superfreiburgertum denn auch kulturell noch ein Versprechen? Die Idee von etwas Unvorhergesehen, von Spannung und Resonanz, wie sie der aus dem Schwarzwald stammende Soziologe Hartmut Rosa sich in Städten erhofft: In Freiburg wird kulturell derzeit wenig aufgebrochen, Experimente finden kaum statt, sei es in der Stadtplanung, im Innerstädtischen oder in den angejahrten, immergleichen Kulturzentren. Egal, ob es um die völlig übertriebene Tanztheaterfixiertheit, die überregional irrelevanten Museen oder die 900-Jahr-„Galas“ geht, die der OB wie eine Schultheateraufführung abhielt: als örtliche Kulturrituale erinnern sie stets ein wenig an die Sparkassen-Antiwerbung mit der 0815-Bank: „Wir machen die Fähnchen.“

Die Stadt als knuffige Komfortzone? Ein paar Zumutungen wären erwünscht.
Ausnahmen bestätigen die Regel, dazu zählen das Freiburger Literaturhaus mit seinem erlesenen Programm. Oder die jungen Galeristen von Delphi/gvbk. Was als Stadtteilinitiative im Arbeiterkiez Beurbarung begann, ist inzwischen auch ein Fixpunkt an einer Brache beim Hauptbahnhof. An einer Ecke, wo die Stadtentwicklung vor zehn Jahren eingestellt wurde, findet in einem leerstehenden Computerladen nunmehr ein rascher Wechsel spannender Ausstellungen statt.
Daniel Vollmer und Max Siebenhaar sind neue Akteure in einer Kunstszene, in der sonst die immergleichen Häuser immergleich gefördert werden, Relevanz hin oder her. Vollmer sagt, man sei gut aufgenommen worden, habe aber mit dem Konzept neuer künstlerischer Strömungen in Off-Spaces und mit Künstlern von außerhalb auch praktisch keine Konkurrenz. „Viele Kreative und Künstler von hier wandern ab, es gibt keine Kunst-Initiativen und -Unis“, wer als junger Kunstakteur nachkomme, müsse kämpfen. Dies gelingt mit Unterstützung der Stadt, aber auch des Projektentwicklers Unmüssig, der einen Großteil der Miete erlässt.
So stehen Vollmer und seine Delphi-Kollegen für eine Kunstwelt, die den Leerstand für Aufwertung nutzt, damit eventuell wieder Besserverdiener oder Investoren angelockt werden. Mit einem Unterschied, sagt Daniel Vollmer: Es sei eine Zwischennutzung in einer Stadt, die bereits gentrifiziert ist.
Freiburg als knuffige Komfortzone: Ein paar Leerstellen für außergewöhnliche Kunst und andere Zumutungen wären erwünscht.