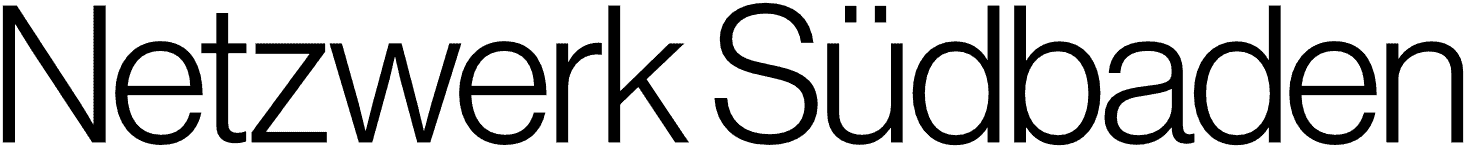Drei junge Menschen, drei Höfe, eine klare Haltung: Landwirtschaft ist für sie kein nostalgisches Aussteigerprojekt, sondern eine bewusste Entscheidung für regionale Ernährung und wirtschaftliche Eigenständigkeit.
Text: Christine Weis
Das Landwirtschaftliche Bildungszentrum Hochburg bei Emmendingen liegt auf einer Anhöhe unterhalb der gleichnamigen Burgruine. Die ist eine der größten am Oberrhein und rückt bei der Anfahrt schon von weitem ins Blickfeld. Der Schulungsort hat zwar keine so alte Historie wie die Burg aus dem 11. Jahrhundert, doch auch er wartet mit einer beachtlichen Geschichte auf: Großherzog Lepold von Baden hat an diesem Ort 1846 eine Ackerbauschule gegründet. Nach wie vor werden hier junge Menschen in Landwirtschaft, Hauswirtschaft und Weinbau ausgebildet. Drei von ihnen haben wir getroffen, um zu erfahren, warum sie sich für diesen Beruf entschieden haben.
Susanne Krieg (35), Carlo Schmidle (23) und Stefan Müller (25) besuchen die Landbauklasse und absolvieren eine zweieinhalbjährige Weiterbildung. Ab November 2027 dürfen sie sich dann Landwirtschaftsmeister nennen. Auf ihrem Stundenplan stehen neben Ackerbau, Pflanzenbau, Tierhaltung und Umweltschutz auch Betriebswirtschaft, Agrarpolitik, EDV, Marketing, Recht, Steuern und Versicherungen.

Susanne Krieg: Bauernhof – aber modern
„Ich habe erst relativ spät den richtigen Weg gefunden“, sagt Susanne Krieg. Aufgewachsen auf einem Bauernhof in Eckartsweier im Ortenaukreis, kannte sie die körperliche Arbeit von klein auf. Gerade weil sie wusste, wie viel Einsatz so ein Hof erfordert, wollte sie etwas anderes machen – und auf keinen Fall einen Landwirt heiraten. Mit 18 zog sie aus, machte eine Ausbildung zur Justizfachangestellten. Und dann kam doch alles anders: Sie verliebte sich – in einen Landwirt. „Tja“, sagt sie lachend, „so schnell kann man seine Meinung ändern ,manchmal hat das Leben andere Pläne“.
Mit Anfang zwanzig zog sie auf den Hof ihres Mannes im Kehler Ortsteil Odelshofen. „Da habe ich erstmal gemerkt, wie viel sich in den paar Jahren, in denen die ich weg war, in der Landwirtschaft verändert hatte“, erzählt sie. Der Betrieb war modern aufgestellt, etwa mit GPS-gesteuerten Maschinen, das war nicht mehr das, was sie von zuhause kannte.
Heute bewirtschaftet sie gemeinsam mit ihrem Mann und einem Minijobber 180 Hektar: Hafer, Mais, Gerste, Weizen, darunter auch 40 Hektar geförderte Flora-Fauna-Habitat-Mähwiesen. Das sind besonders arten- und blütenreiche Wiesen, die durch ökologische Bewirtschaftung entstehen, erklärt Susanne Krieg.
„Wir leisten einen wichtigen Beitrag zum Selbstversorgungsgrad der Region.“ — Susanne Krieg
Warum jetzt die Meisterschule? „Mein Mann ist Bioinformatiker und Landwirt, ich fand es einfach wichtig, ebenfalls eine fundierte Qualifikation zur Absicherung des Betriebs zu haben“, sagt sie und fügt hinzu: „Wir ergänzen uns perfekt, die Arbeit macht uns Freude – und sie ist sinnvoll.“ Das Paar hat drei Kinder. Ob eines von ihnen den Hof einmal übernimmt? „Das wäre schön – immerhin besteht der Betrieb seit dem 17. Jahrhundert. Aber es ist kein Muss. Wichtig ist, dass sie glücklich sind.“
Carlo Schmidle: Hof-Reanimation mit Herzblut
In der Familie von Carlo Schmidle war die landwirtschaftliche Tradition eigentlich schon beendet. 2010 musste sein Großvater den Hof in der Ortsmitte von Heitersheim aus gesundheitlichen Gründen aufgeben – ein kleiner Mischbetrieb mit Kühen, Schweinen, Hühnern und Pferden. Seitdem steht das alte Fachwerkhaus samt Stall leer, die Felder waren verpachtet. „Ich werde den Hof in den nächsten Jahren wiederbeleben“, sagt Carlo Schmidle entschlossen. Es war ihm schon früh klar, dass er Landwirt werden wollte.
„Der Fleischkonsum geht kaum zurück, aber die heimische Tierhaltung schon das ist paradox.“ — Carlo Schmidle
Neben seiner Arbeit als angestellter Landwirt auf der Fröhlin Farm in Buggingen, einem Schweinezuchtbetrieb, treibt er sein eigenes Projekt voran. „Ich fange mit Ackerbau an“, erzählt der 23-Jährige. Erste Flächen hat er bereits aus der Pacht zurückgeholt, die er nun bewirtschaftet. Mais, Weizen, Gerste – Schritt für Schritt baut er die Agrarstruktur auf. Wo viele andere aufgeben, sieht er Chancen: „Es gibt genügend freie Flächen, auch Saatgutverwertung wird wieder interessanter. Ich habe einfach Lust, da voll reinzugehen.“ Familie und Freunde unterstützen ihn, auch wenn Landwirtschaft in seiner Generation eher die Ausnahme ist, aber das sei ihm egal.
Sein besonderes Anliegen ist das Tierwohl. „Viele Tiere aus dem Ausland leiden auf langen Transportwegen, das muss nicht sein.“ Sein Appell: Regional erzeugte Lebensmittel kaufen. „Der Fleischkonsum geht kaum zurück, aber die heimische Tierhaltung schon, das ist doch paradox.“ Was mag er besonders an seinem Beruf? „Das gute Gefühl am Abend, wenn man sieht, was man geschafft hat, egal ob auf dem Feld oder im Stall. Und die Abwechslung: Nach dem Stall freue ich mich aufs Schlepperfahren und umgekehrt.
Stefan Müller: Zukunft Kuh
Stefan Müller musste nicht bei null anfangen. Seine Eltern hatten den Betrieb frühzeitig modernisiert und in einen neuen Stall investiert. Der 25-Jährige bewirtschaftet heute einen Milchviehbetrieb in Unterharmersbach im Kinzigtal. „Wir sind sieben Geschwister, alle hatten Interesse, den Hof zu übernehmen.“ Dem Vater sei es wichtig gewesen, dass jedes der Kinder zunächst ein Handwerk lernt. Stefan wurde Heizungsinstallateur, bevor er sich für die Landwirtschaft entschied. Als klar war, dass er den Hof weiterführt, war er in alle Entscheidungen eingebunden, sei es bei der Installation einer PV-Anlage auf dem Güllebehälter oder bei der bewussten Reduktion der Obstbäume.
„Es gibt ständig Entscheidungen zu treffen, vieles ist komplex. Aber genau das finde ich gut, es wird nie langweilig.“ — Stefan Müller
Seit vergangenem Jahr steht er voll in der Verantwortung: 120 Hektar Fläche, 40 Milchkühe im Laufstall mit Sommerweide, eigene Nachzucht, Wald mit Energie- und Bauholz. „Ein normaler Tag fängt früh an und endet spät. Zwölf Stunden sind Standard“, sagt Stefan Müller. Über Arbeitszeiten macht er sich aber eigentlich keine Gedanken. Seine Partnerin hilft morgens und abends im Stall mit – obwohl sie hauptberuflich Betriebswirtin in einem Verpackungsunternehmen ist. Auch Hund, Katzen und Hühner gehören zum Hofleben: „Ein bisschen Bullerbü gibt’s bei uns schon“, sagt er.
Was findet er erfüllend in dem Job? „Kein Tag ist gleich. Man muss flexibel sein – auch mental. Es gibt ständig Entscheidungen zu treffen, vieles ist komplex. Aber genau das finde ich gut, es wird nie langweilig.
Herausforderungen und Hightech
Alle drei berichten von einem Alltag, der zunehmend durch bürokratische Auflagen, Dokumentationspflichten und Förderbedingungen geprägt ist. „Man kämpft sich durch ein Labyrinth aus Paragrafen“, sagt Susanne Krieg. Gleichzeitig steigen die Herausforderungen durch den Klimawandel: Wetterextreme werden häufiger, die Zeitfenster für Aussaat und Ernte enger. „Im vergangenen Jahr war der Mais nicht verdorrt, aber der Weizen stand im Wasser“, erinnert sie sich.
Um wettbewerbsfähig zu bleiben, setzen sie auf moderne Technik. Precision Farming ist das Schlagwort, eine präzise, digitale Form der Landwirtschaft. Mit Hilfe von GPS, Sensoren und Satellitendaten werden Saatgut, Wasser und Dünger punktgenau ausgebracht. „Es geht nicht nur um Effizienz, sondern um Umweltschutz – auch im konventionellen Bereich“, sagt Carlo Schmidle. „Wir haben nur diese eine Natur. Wenn wir sie ruinieren, ruinieren wir uns selbst.“
Kritik und klare Worte
Skandale rund um Nitratwerte, CO2-Ausstoß oder Massentierhaltung treffen sie hart. „Es gibt schwarze Schafe – wie in jeder Branche“, sagt Stefan Müller. „Aber das ist nicht die Regel.“ Oft fehle es an Wissen: Beweidetes Grünland etwa speichere Kohlenstoff – entgegen der Kritik an klimaschädlichen Kühen und Rindern.
Auch persönliche Angriffe bleiben nicht aus. „Ich wurde beim Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln schon als Umweltvergifterin beschimpft“, erzählt Susanne Krieg. „Ich nehme mir dann die Zeit, um zu erklären, was wirklich auf dem Acker passiert.“
Bei Carlo Schmidle wachse die Sorge vor Billigimporten aufgrund des Freihandelsabkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay. „Die Standards in Südamerika liegen oft weit unter unseren“, sagt er. Und dennoch stehe man mit deren Preisen in Konkurrenz. Eine Entwicklung, die den Tieren und den heimischen Betrieben schade.
Die Lösung sehen sie in der Regionalität – ob Bio oder konventionell. „Wir sollten uns an der Schweiz orientieren: klare Regeln, starke Förderung und echte Wertschätzung für heimische Produkte“, findet Susanne Krieg. Und sie wünschen sich mehr gesellschaftliche Anerkennung und faire Rahmenbedingungen. „Wir leisten einen wichtigen Beitrag zum Selbstversorgungsgrad der Region“, sagt Susanne Krieg.
Trotz aller Schwierigkeiten brennen sie für ihren Beruf. Während in Baden-Württemberg zwischen 2020 und 2023 rund drei Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe verschwanden, so die Zahlen des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands (BLHV), halten Susanne Krieg, Carlo Schmidle und Stefan Müller gegen diesen Trend. Sie geben der Landwirtschaft ein Gesicht, eine Stimme – und eine Zukunft.