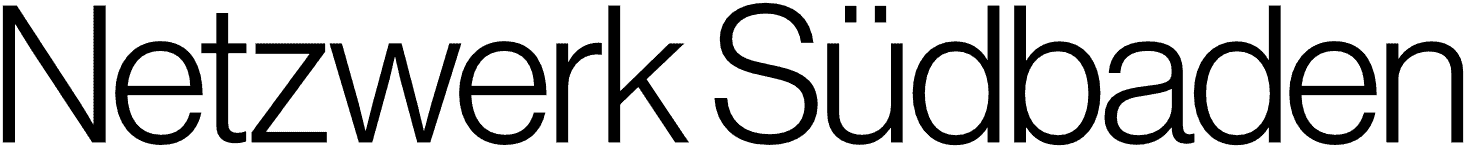Das „Obstgut Siegel“ im Markgräfler Land verkörpert eine Brücke zwischen modernem und traditionellem Anbau. Der Demeter-Betrieb unternimmt auf 65 Hektar viel für die Pflege der Landschaft.

Joel Siegel (39) hat um neun Uhr morgens eine volle Nachtschicht auf dem Feld in den Knochen: Ende März hat noch einmal der Frost zugeschlagen, als die ersten Bäume bereits austrieben. Das Jahr könne wild werden, wenn das so weiter geht, sagt er über den ungünstigen Zeitpunkt. „Aber ich nehme das nicht mehr persönlich.“ Stattdessen ringt der Demeter-Landwirt Siegel, der in einem konventionellen Betrieb gelernt hat, in diesen Nächten mit der Natur, um seine Kulturen vor der Zerstörung zu retten: Gestern war er dafür mit einem Hänger unterwegs, den er in Ungarn gekauft hat. Darauf verbrennt er leicht verfügbare Rohstoffe, Stroh, Holz oder Schnittabfälle, die Heißluft wird vom Hänger aus wie mit einem Gebläse zwischen den betroffenen Aprikosen- und Pfirsichbäumen verteilt. Mit viel Aufwand schaffen es die Pflanzen von -8 Grad Celsius auf noch verträgliche -4.
Im Vorjahr fand sich ein Foto seiner bei Frost illuminierten Felder bundesweit in die Medien. Was so schön aussah, waren damals dicke Paraffin-Kerzen, die er zur Erwärmung aufgestellt hatte. Die Folgen des vermeintlich pittoresken Bildes erklären den irrwitzigen Überlebenskampf der heutigen Landwirtschaft: Aus einem Hersteller der Spezialkerzen wurden schlagartig fünf, der Preis stieg trotzdem im Schnitt von vier Euro pro Stück auf zehn bis zwölf Euro, dafür brannte sie zwei Stunden kürzer, Geldmacherei. Siegel hätte pro Frostnacht bis zu 10.000 Euro ausgegeben. Deshalb jetzt der Hänger aus Ungarn. Wenn man so will, ist Siegel mit seinem Zwang zur Improvisation ein wenig der SC Freiburg seines Berufs: Einer, der immer ideenreich basteln muss, wenn ihm wieder eine Innovation genommen wird. Der mit „was neuem Alten“, wie er den ungarischen Hänger nennt, gegensteuert und sich schon wieder das nächste überlegen muss: denn auch dieses Zubehör befindet sich aktuell im Preisanstieg.

Joel Siegel, bewirtschaftet aktuell 65 Hektar auf einem Hof zwischen Mengen und Norsingen im Markgräfler Land: 16 Sorten Äpfel, sechs Sorten Birnen, Rhabarber, alle Arten von Beeren, Zwetschgen, Nektarinen, sogar Melonen – eine großartige Fülle. Und wer sich mit ihm unterhält, kriegt einen vielfältigen Einblick in die Lage der heutigen Landwirtschaft. Weil Siegel wunderbar über den Demeter- Tellerrand und den Horizont eines Jahres hinaus zu schauen vermag. Dass er mit das beste Obst der Region in die Läden bringt, ist vielleicht ein Effekt davon. Vom Nachtfrost findet er recht rasch zum Berufsbild im Allgemeinen: Das würden sich viele nicht mehr antun, weil man nicht nur bereit sein müsse, „Niederlagen einzustecken“, sondern auch Gefahr laufe, als Ganzes zu scheitern. Er selbst macht diesen Beruf in voller Leidenschaft mit der Mission, einen Boden besser zu hinterlassen, als er ihn vorgefunden hat. Es gibt sicher junge Menschen, die das auch wollen, sagt er, aber es bleibt zu bezweifeln, ob es alle auch können. „Die wenigsten schätzen es realistisch ein“. Siegel sagt, er glaube an das Gute im Menschen, aber nicht an das System. Dieses sehe nicht vor, dass der Preis für die Pflege der Landschaft noch irgendwo enthalten sei, wenn ein Kilogramm Äpfel für 17 Cent an Supermärkte abgegeben werden soll.
„Die Luft wird dünner“, sagt Siegel, auch weil die vier großen Lebensmittel- Einzelhändler Aldi, Lidl, Rewe und Edeka nicht nur Ausverkauf-Tendenzen bei den Bauern begünstigten. Sondern auch, weil sie stellenweise daran gingen, Großhandelsstrukturen im Bio-Bereich aufzulösen. Das könnte mittelfristig dazu führen, dass die Preise gegenüber den Erzeugern nach Belieben diktiert werden. Sein Gegenentwurf neben dem Glauben ans Gute: Qualität. Aber eben auch Innovation, wenn es um die Pflege der Kulturen und den Handel zu fairen Bedingungen geht. Joel Siegel beschäftigt ein Team von Mitarbeitern aus der Region, zu der auch das Elsass zählt – Siegel ist selbst Franzose – aber auch aus dem Osten Europas. Er nimmt auf unterschiedliche Mentalitäten Rücksicht und bietet eigene interne Fortbildungen an. Deutschen Mitarbeitern sei bisweilen schwer zu vermitteln, warum eine vier- oder fünf-Tage-Woche auf dem Hof schwer möglich ist.


Trotzdem muss er wie für einen Hausbau aberwitzige Baugenehmigungen für den mobilen Hänger beantragen, Anfragen von ihm nach vor- Ort-Terminen bleiben unbeantwortet. Siegel muss allen Ernstes Auskunft geben, ob er eine Männer- und Frauen-Toilette einzubauen gedenkt – im Hühnerstall. Jeder Werbe-Anhänger im öffentlichen Raum sei immobiler, sagt Siegel, der die Genehmigungspraxis im restlichen baden-württembergischen Raum klar auf seiner Seite sieht. Den Großteil des Arbeitstages bringt er für Kontrollen, Bürotätigkeiten und Vermarktung ein. Im Winter sei er täglich vier Stunden draußen, wenn keine Frostnächte ein Durchmachen erforderten. Ab Frühjahr kann er dort gerade noch nach dem Rechten sehen und delegieren, was seine Mitarbeiter ausführen. „Das ist sicher nicht das, warum ich Landwirt werden wollte“, sagt er leise. Joel Siegel wird es trotzdem nicht persönlich nehmen. Und weiter an das Gute glauben. Mit wachem Geist gegen die Erschöpfung der Böden.
Von Rudi Raschke