Vor unserer Haustür vollziehen sich bei den Schweizer Nachbarn Entwicklungen, die auch für die deutschen Medien ein Thema werden können: Nicht nur der Streit um das Abgaben-finanzierte Fernsehen – vielmehr auch unabhängige Publikationen, die vieles auf den Kopf stellen, was klassische Zeitungen an Inhalt, Finanzierung, Vertrieb und Besitzverhältnissen kennen. Zu Besuch bei der „Republik“ in Zürich.
Von Rudi Raschke
Wir brauchen Artikel, die die Leute weghauen.“ „Wir müssen liefern oder wir sind geliefert.“ „Wir haben einen verdammten kleinen Konzern aus dem Boden gestampft, eine Höllenmaschine“. Constantin Seibt ist einer der Gründer des Magazins „Republik“ und hat nicht nur den einzig brauchbaren Journalismus-Ratgeber der letzten Jahre („Deadline“) geschrieben – er liefert auch verlässliche Einstiegssätze für einen Beitrag über sein Projekt.
Seibt, 52, sitzt in der Kaffeeküche der „Republik“ und spricht darüber, wie es überhaupt dazu kam. Dass er mit ein paar Weggefährten eine etablierte Zeitung wie den Zürcher „Tages-Anzeiger“ verließ. Dass er „Gesellschafter“ für ein Magazin zu sammeln begann. Dass es inzwischen 20.000 sind, die meisten von ihnen bezahlen 240 Schweizer Franken für ein Jahr, manche spenden mehr, einige bezahlen, soviel sie halt können. Dafür kriegen sie drei hochwertige Online-Artikel pro Tag, Themen aus Zürich, der Schweiz, dem europäischen Ausland und der ganzen Welt. Er sei damals im Büro gesessen, „gutbezahlt, privilegiert“, Seibt war Vorzeige- Reporter und -Kolumnist, ein bisschen sei er das „Zuckerpüppchen“ gewesen, als das Asterix als Sklave in den „Lorbeeren des Cäsar“ dient. Dessen Comic-Dienstherr „Claudius Überflus“ war in Seibts Realität der tamedia-Verlag.
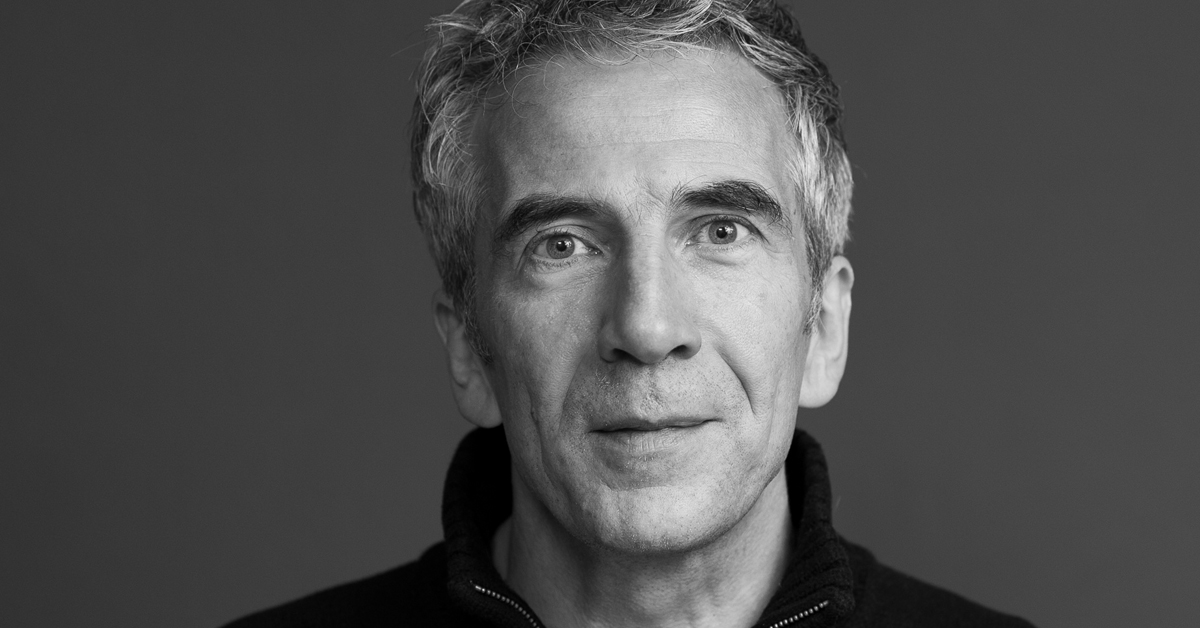
Neben der bleiernen Routine von „langweiligen Sitzungen und abwesenden Chefs“, sagt Seibt, habe sich gleichzeitig sein Gefühl verfestigt: „Was ich mache, ist egal. Ich bin der Klavierspieler auf der Titanic.“ Ende 2016 hat er das glanzvolle Schiff auf Eisberg-Kurs verlassen. Gemeinsam mit seinem Kollegen Christof Moser hat er ein Konzept erarbeitet, das schlau sein wollte, aber auch einflussreich, das Businesspläne kennt und IT-Kompetenz um sich weiß. Und alles deutlich oberhalb der Wahrnehmungsschwelle. „Wir wollten einen Flicken auf das zusammenbrechende System setzen.“ In ihrer Kampagne um Geldgeber wäre dieses Statement gerade mal das Aufwärmprogramm gewesen. In der Schweiz ist es unüblich, mit Pathos anzutreten, genau das war aber die Haltung von Seibt und Konsorten: Sich nicht kleiner zu machen. Sie haben ein Manifest verfasst und gleich die „Republik“ ausgerufen, unterhalb eines Epochenwechsels wollten sie nicht antreten. Und sie haben klargemacht, dass eine Demokratie ohne freie, unabhängige Presse stirbt. Am Ende sind die Menschen im Regen angestanden, als die ersten Anteile verkauft wurden. Sie sollten nicht Abonnenten werden, sondern „Gesellschafter“.
Zu ihnen gesellten sich Investoren und Großspender. Rund ein Jahr verging zwischen der Proklamation des neuen Journalismus und der ersten Ausgabe. Aus einem Ehrenamt- Team von sechs Leuten sind inzwischen 40 Festanstellungen in Voll- oder Teilzeit geworden. Die IT hat geholfen, dass das Team lösungsorientiert denkt und eine eigene Programmierung aufgesetzt wurde. Eine Top-Campaignerin hat geholfen, dass die Schlange bis heute anhält. 25.000 Verleger sollen es in der nächsten Zeit werden. Vom Bordpianisten auf dem sinkenden Schiff zur Gallionsfigur des freien Journalismus: Das funktionierte für Seibt nur ohne Anzeigen – es gibt keinerlei Werbung – und mit dem Selbstverständnis, die Leser „verführen“ zu wollen.
Die Gesellschafter werden als „Komplizen“ betrachtet, aber auch als Chefs. Keine Kunden, denen man ein „sie wünschen, wir schreiben“ vorsetzt, sondern begeisterungsfähige Menschen, deren Intelligenz nie unterschätzt wird. Denen man auch mal respektlos begegnen kann, wenn es gut begründet ist. Und die man mindestens einmal im Monat ausnahmslos begeistern will. Seibt will seine Leser-Gesellschafter „ins Herz treffen.“ Die „Republik“ bietet keinen Bullshit, keine Grundversorgung mit Pressekonferenz- Pflichtstoff aus Gremien und Verbänden. Sie will individuell, frech und mutig sein und mittendrin. Auch mit der Büro-Location: Am Eingang der Zürcher Langstraße haben sie das ehemalige Hotel-Etablissement „Rothaus“ gemietet, in der Nachbarschaft leben Trend-Clubs, Ethnoküchen und Sexkinos Tür an Tür, unterm Raucherbalkon können sie die Razzien sehen.
Laut Seibt der „raueste Teil Zürichs“. Das von ihm mitgeschaffene Monster fordert ihm an diesem Tag auch drinnen einiges ab: Seibt ist wegen Bewerbergesprächen eine Stunde zu spät in der Kaffeeküche erschienen, zwischendurch wird er gebeten, den Newsletter-Text für die Artikel des morgigen Tages zu schreiben und verschwindet noch einmal für eine Dreiviertelstunde. Es herrscht ein anderes „Raum-Zeit-Gefühl“ zwischen hektischem Tagesgeschäft und jenem langsamen Denken, das die „Republik“ in ihren klugen Beiträgen proklamiert.
Der reflektierte Irrsinn. Der in Deutschland geborene Seibt raucht und spricht ein wenig wie ein Westernheld, immer etwas eckig, cool und draufgängerisch. Während des Wartens auf ihn lässt sich in der Kaffeeküche seiner Mit-Outsider erleben, dass das hier ein wenig die WG-Küche, aber auch der postfuturistische Newsroom des Journalismus ist: Alles anders als in jenen Hochglanz-Verlagshäusern der Lokalzeitungen, wo junge Menschen gemeinsam auf Monitore starren, dass ein paar kleine Neuigkeiten rauspurzeln. Statt zum Recherchieren vor die Tür zu gehen. An der Wand über Kaffeemaschine und Wasserkocher rutschen auf Displays die Porträtfotos der Geldgeber im Durchlauf durch, es schaut aus wie eine Dating-Börse der Gesellschafter. Immer wieder kommen Mitglieder des Teams rein, um sich über Texte, Personalien oder Ideen zu unterhalten.
An den Wänden sind „Ihr werdet scheitern“-Briefe ausgehängt (Beschriftung: „Denkzettel!“) oder die Anfragen großer Medienagenturen nach Anzeigenpreisen („Satire!“). Seibt wird später sagen, dass sich das Schreiben im einstigen (Stunden-)Hotel fast wie Literatur anfühle. Und tatsächlich entstehen hier nicht nur andere Geschichten, vor allem längere – er selbst hat mit einem großartigen Premierentext die Messlatte aufgelegt. Es ging um die drohende Abschaffung der Schweizer Öffentlich- Rechtlichen, aber auch um das Verschwinden des Rationalen im politischen und im allgemeinen Denken, am Ende letztlich um die eigene Arbeit im „Hotel Rothaus“.
Wo sie nach Auswegen aus den Missverständnissen zwischen Redaktionen und Lesern suchen. Die „Republik“ ist ganz im Sinne von Alfred Hitchcocks altem Spruch mit einem Erdbeben gestartet und hat sich dann langsam gesteigert. „Wir sind jetzt bei 60 bis 70 Prozent“ sagt Seibt über die Qualität, aber auch, dass er von der großen Verantwortung nach dem ersten Erfolg überrascht wurde, „Du lernst Demut“. Die nächste Deadline steht im Januar 2019 an, wenn nahezu alle Abos auslaufen. Keiner weiß, ob es nicht wie bei manchem Journalismus- Startup 70 Prozent sind, die abspringen. Auch darüber führen sie leidenschaftliche Debatten, zu denen sie ihre Gesellschafter einladen. Auffallend, wie die „Republik“ dabei einen Ton trifft, den etablierte Zeitungen nicht mehr zu kennen scheinen: herzlich, nahbar, mitfühlend, aber immer kritisch. Das ist das Fundament, auf dem sie alles ausprobieren: immer online (weil ein täglicher Druck vielzuviele Kosten im nicht-Journalistischen verursachen würde), aber mit Newslettern, pdf-Versand, auch Hörartikeln im Podcast. „Ein Magazin ist heute zur Hälfte ein IT-Unternehmen“, sagt Seibt.
Für ihn ohne Rückkehrmöglichkeit: Er findet, dass die „Lizenz zum Gelddrucken“ für die klassischen Zeitungshäuser ausgelaufen sei. Von den früheren drei Monopolen auf Werbegeld, Neuigkeiten und die Abonnenten-Lektüre zur Zigarette nach dem Frühstück seien zwei gefallen. Mindestens. Überleben könne die „Republik“ dann, wenn sie weiter antizyklisch vorgeht, Geschichten dann bringt, wenn sie gut sind, ohne Terminzwang. Trotz der 20.000 Geldgeber sei es ein „Projekt gegen jede Wahrscheinlichkeit“. „Wir sind noch lange nicht über den Berg, wir können es noch selbst vermasseln.“ Was alles täglich passiert, wenn ein hintergründig denkender Autor zum unkonventionellen Medienmanager wird? „Wenn wir unsere to-do-Liste irgendwo auftätowieren müssten, bräuchte es einen Zwergwal.“ Schöner Schlusssatz. Der Kampf geht weiter.

