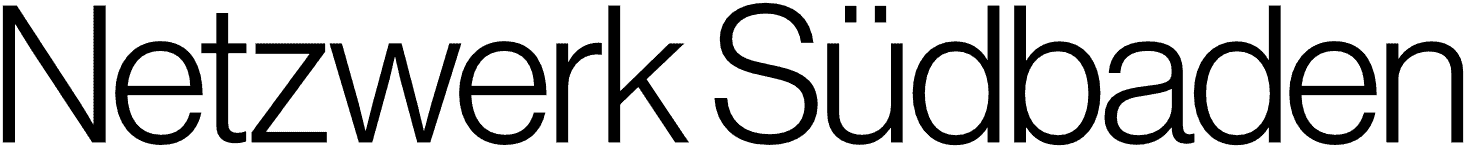Anspruchsvoll, sehr technikaffin und weniger sozialkompetent: Unser gängiges Bild von Jugendlichen übersieht, wie heterogen die Generationen Z und Alpha sind. Wir haben uns bei privaten Bildungsträgern und einem sozialen Verein einen Eindruck verschafft.
Text: Kathrin Ermert
Sie sind die wahren Digital Natives. Sie machen schon in der Grundschule Powerpoint-Präsentationen. Sie können schneller auf dem Handy als auf einer Tastatur tippen, streamen Musik und Filme, informieren sich über Tiktok, Instagram & Co. Die Generation Z (zwischen 1995 und 2009) hat zumindest einen Teil ihrer Kindheit ohne Smartphone verbracht, dessen Siegeszug erst 2007 begann. Die Folgegeneration Alpha indes, die jetzt zwischen null und fünfzehn Jahre alt ist, kennt kein Leben ohne Apps und Social Media. Diese Kinder und Jugendlichen schauen laut Studien sieben bis acht Stunden pro Tag auf Bildschirme. Entsprechend kurz ist ihre Aufmerksamkeitsspanne, und manchen mangelt es an sozialer Kompetenz, vor allem seit man sie während der Coronapandemie monatelang im Homeschooling isolierte. Sie wachsen mit Krisen und Kriegen auf, sind deshalb sehr familienorientiert und haben ein hohes Sicherheitsbedürfnis, sagt der Jugendforscher Simon Schnetzer.
Remote, flexibel, anspruchsvoll
Das bemerkt Arne Kuder, wenn er auf die Adressen seiner Studierenden schaut: „Die verlassen kaum noch ihren Postleitzahlenbereich.“ Kuder, der zu Innovationsmanagement und Unternehmertum promoviert hat, leitet die Studienbereiche Hotel- und Eventmanagement an der Internationalen Studien- und Berufsakademie (ISBA) in Freiburg, einer privaten dualen Hochschule mit rund 300 Studierenden in fünf Studiengängen. Die Jüngsten der Generation Z kommen bald auf den Arbeitsmarkt, alle Planungen richten Kuder und sein Team nun an den Alphas aus. Das betrifft sowohl Studieninhalte als auch -strukturen. Ein Beispiel: Weil künstliche Intelligenz mittlerweile bei so gut wie jeder Studienarbeit mitschreibt, ändert die ISBA die Benotung. Früher zählte die schriftliche 80, die mündliche 20 Prozent. Mittlerweile wird die mündliche Leistung stärker gewichtet, künftig soll sie sogar die Note dominieren.

„Das sind die Neuen, mit denen müssen wir zurechtkommen.“
Arne Kuder hat zu Innovationsmanagement und Unternehmertum promoviert, leitet die Studienbereiche Hotel- und Eventmanagement an der Internationalen Studien- und Berufsakademie (ISBA) in Freiburg und hat selbst zwei Alphas daheim.
Ein anderes Beispiel praktiziert die ISBA jetzt schon. Sie lässt die Studierenden Kurse auch remote verfolgen. Dann bewegt sich eine sogenannte Eule für die digital Anwesenden durch den Raum. „Seit wir das anbieten, haben wir weniger Fehlzeiten“, sagt Kuder und betont: „Die Dozentinnen und Dozenten müssen so gut sein, dass die Studierenden lieber vor Ort sind.“ Die erwarten Gamification, also spielerisches Lernen, und – vor allem an einer kleinen dualen Hochschule – individuelle Betreuung. „Zu uns kommen diejenigen, die das Verschulte mögen. Die enge Zusammenarbeit ist unser USP.“ Das beginnt schon bei der Auswahl der Praxisteile: Drei Mitarbeitende der ISBA kümmern sich nur um das sogenannte Matching, helfen also bei der Suche nach dem passenden Unternehmen. Die Identifikation mit dem Arbeitgeber sei jungen Leute sehr wichtig, sagt Kuder. Außerdem hätten sie hohe Erwartungen an die technische Ausstattung und lehnten starke Hierarchien ab, im Job wie im Studium.
Kuder, der selbst zwei Alphas daheim hat, hält nichts davon, über die jungen Leute zu meckern. „Das sind die Neuen, mit denen müssen wir zurechtkommen. Ich muss meinen Bias aufräumen – das sollten die Unternehmen auch tun.“ Flexibilität ist seiner Meinung nach künftig nicht mehr verhandelbar. „Den Nine-to-five-Job wird es nicht mehr geben.“
Kita, Grundschule, Gemeinschaftsschule
Ein anderer Trend: Die soziale Kompetenz der Studis habe seit der Coronazeit deutlich abgenommen, berichtet Kuder. Das zeige sich zum Beispiel in Gruppenarbeiten. Entsprechend gewinnt Persönlichkeitsentwicklung selbst in der dualen Hochschule an Bedeutung. „Eltern fördern weniger soziale Skills, weil sie keine Zeit haben. Aber wir sehen das positiv: Wenn Bildungsträger das für alle anbieten, ist es eine Form der Gleichberechtigung“, sagt Robert Wetterauer. Er ist Geschäftsführer innerhalb des Kolping-Bildungswerks (KBW) und in Freiburg für die ISBA zuständig. Die Angell-Akademie mit drei beruflichen Gymnasien und zwei Berufskollegs, mit der sich ISBA das Gebäude an der Kronenbrücke teilt, gehört auch zur KBW-Gruppe. Außerdem verantwortet Wetterauer den Kopernikus Bildungscampus, der im Stadtteil St.Georgen entsteht, seit KBW 2023 die kleine private Kopernikus-Grundschule aus der Insolvenz rettete.

„Eltern fördern soziale Skills weniger, weil sie keine Zeit haben.“
Robert Wetterauer ist Geschäftsführer innerhalb des Kolping-Bildungswerks (KBW) und in Freiburg für die ISBA sowie den Kopernikus-Bildungscampus zuständig. Seine Eltern haben jahrelang das Montessorizentrum Angell jahrelang geleitet.
Zum Jahresbeginn hat auf dem Gelände eine Kita für 40 Ein- bis Sechsjährige eröffnet. In gut einem Jahr soll zudem eine Gemeinschaftsschule an den Start gehen – der Antrag dafür liege gerade beim Regierungspräsidium, die Räume neben der Grundschule seien schon vorhanden, berichtet Wetterauer. Wem der Name bekannt vorkommt: Sein Vater Dieter Wetterauer, nach dem die Turnhalle am Ende des Zubringers benannt ist, und seine Mutter Antoinette Klute-Wetterauer haben das Montessorizentrum Angell aufgebaut und jahrelang geleitet. Macht Wetterauer junior dem nun Konkurrenz? „Nein“, sagt er. Das neue Angebot decke den Bedarf im Südwesten Freiburgs und der umliegenden Gemeinden ab. Selbst aus Bad Krozingen und Kaiserstuhlgemeinden kämen Bewerbungen.
Schon jetzt besuchen 25 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Freiburg Privatschulen, bundesweit tun dies nur 9 Prozent. Das liegt an sehr großen Anbietern in der Stadt wie dem St.Ursula-Gymnasium mit mehr als 1000 Schülerinnen oder eben den Angell-Schulen. Und es zeigt, dass gerade in akademisch geprägten Städten wie Freiburg einige Eltern für die schulischen Erfolge ihrer Kinder keine Kosten scheuen. Doch es gibt auch viele Kids, denen kein roter Teppich zum Abitur ausgerollt wird, die sich oft ohne Unterstützung der Eltern durchs Bildungssystem kämpfen.
Spielen, lernen, ankommen
Amaya* zum Beispiel. Sie ist 17 Jahre alt und besucht die neunte Klasse der Karlschule. Amaya hofft, dass sie das Schuljahr schafft und weiter in die zehnte Klasse gehen kann. Das ist ein Grund, warum sie drei Mal die Woche in der Dreisamstraße „Dock3“ besucht. Der Freiburger Verein Stadtpiraten und die Kirchengemeinde Dreisam3 der evangelischen Stadtmission organisieren dieses Lernangebot gemeinsam. Etwa 30 Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren von mehreren Schulen kommen jede Woche freiwillig. „Weil es Spaß macht und weil es mir hilft, gut in der Schule zu sein“, begründet Amaya in ziemlich gutem Deutsch. Sie ist Irakerin, kam vor sechs Jahren zusammen mit ihrer achtköpfigen Familie nach Deutschland und lernte in der Flüchtlingsunterkunft die Stadtpiraten kennen.

„Bei uns passiert viel Beziehungsarbeit.“
Rahel Stoll ist Sozialarbeiterin und leitet den Teenagerbereich Mädchen bei dem Freiburger Stadtpiraten und kümmert sich um das Lernangebot Dock3. Dort passiert außer Nachhilfe viel Beziehungsarbeit, betont sie.

„Dock3 ist mehr als ein Nachhilfeangebot.“
Jannis Vosskuhl ist Diakon für Jugendarbeit bei der Kirchengemeinde Dreisam3 der evangelischen Stadtmission, wo auch das Projekt Dock3 angesiedelt ist. Ihm ist wichtig, mit den jungen Leuten über Gott und das Leben ins Gespräch zu kommen.
Der 2015 gegründete Verein geht in Gemeinschaftsunterbringungen, um mit den Kindern und Jugendlichen dort zu spielen, Sport zu machen, sie beim Ankommen in ihrer neuen Welt zu unterstützen. Im ersten Coronajahr fragten einige der älteren Schulkinder: Können wir mit euch lernen? Die Kirchengemeinde Dreisam3 hatte Räume dafür. So entstanden 2020 die Idee und Kooperation für Dock3, erzählt Sozialarbeiterin Rahel Stoll, die den Teenagerbereich Mädchen bei den Stadtpiraten leitet und sich zusammen mit Jannis Vosskuhl, Diakon für Jugendarbeit bei Dreisam3, um das Projekt kümmert. Vergangenen Herbst konnten sie neue Räume beziehen, nachdem sie gemeinsam mit den Kids Wände und Möbel in frischen, freundlichen Farben gestrichen hatten. Sie brauchten mehr Platz, weil die Nachfrage wächst.
Hier gibt es mittwochs, donnerstags und freitags ein Mittagessen samt Tischgebet vorab sowie viele Gesprächen über Politik und Gesellschaft nebenbei. „Dock3 ist mehr als ein Nachhilfeangebot“, betonen Stoll und Vosskuhl. Missionieren liege ihnen fern, doch die Jugendlichen, die fast alle aus religiösen Familien kommen, fänden das Gebet gut. Nach dem Essen können sie Hausaufgaben machen, für Arbeiten lernen, sich um Berufspraktika kümmern. Ehrenamtliche wie ehemalige Lehrkräfte unterstützen sie dabei. In der Theorie sollen sich Jugendliche mit und ohne Fluchthintergrund bei Dock3 treffen. In der Praxis kommen vor allem Mädchen und Jungen aus irakischen, syrischen, indischen und ukrainischen Familien. Manche hätten hohe Ziele, was sie beruflich erreichen wollen, berichtet Stoll.
„Wenn ein Mensch Träume und Ziele hat, wie das Fachabi zu schaffen, dann lasst sie es probieren.“ – Sara
Amayas Berufswunsch? „Fahrlehrerin vielleicht. Das ändert sich aber immer wieder“, erzählt sie. Der Sozialarbeiter an ihrer Schule finde, sie solle Politikerin werden. Die 14-jährige Samira* will, falls sie das Fachabi schafft, Architektin werden. Ansonsten Kosmetikerin oder Friseurin. Ihre Freundin Sara*, 16 Jahre alt, möchte Lehramt studieren. Sie hat schon ihr Praktikum in ihrer alten Grundschule absolviert. Die beiden sind Stammgäste bei den Stadtpiraten und bei Dock3. Was finden sie hier gut? „Dass ich Hausaufgaben machen kann, die ich in der Schule nicht so gut verstehe, weil die Lehrer es mir nicht erklären können“, sagt Sara. Wenn sie Lehrerin wäre, würde sie die Jugendlichen so behandeln, wie sie es sich wünschen, keine Unterschiede machen, ihnen mehr zutrauen: „Wenn ein Mensch Träume und Ziele hat, wie das Fachabi zu schaffen, dann lasst sie es probieren.“
*die Namen haben wir auf Wunsch anonymisiert